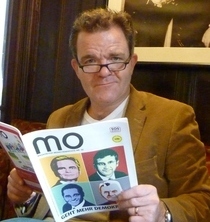Ein juristisches Erdbeben
Die Rechtsanwältin Michaela Krömer hat im Namen von zwölf Kindern und Jugendlichen Klage gegen das Klimaschutzgesetz eingebracht. Ein positives Urteil hätte weitreichende Folgen. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Kommentar: Michaela Krömer, Illustration: Petja Dimitrova
Zum Hintergrund der Klage muss man vorausschicken, dass wir es in Österreich mit mehreren Besonderheiten zu tun haben: Erstens gibt es ein Klimaschutzgesetz, das – mit Ablauf 2020 – keine Verbindlichkeiten und keinen Sanktionsmechanismus kennt. Tatsächlich hat dieses Klimaschutzgesetz zu keiner Reduktion der Treibhausgase geführt. Zweitens sind in Österreich Kinderrechte im Verfassungsrang verankert. Artikel 1 des Bundesverfassungsgesetzes besagt, dass Kinder auch einen Schutzanspruch haben, welcher mit Blick auf Generationengerechtigkeit wahrzunehmen ist. Drittens: Kinderrechte sind zwar inhaltlich stark verankert, aber die Frage ist, wie man diese Rechte geltend machen kann.
Welche Beschwerdemöglichkeiten sind damit verknüpft? Das Verfahren, das ich im Namen von zwölf Jugendlichen führe, verknüpft diese drei Aspekte. Denn Kinder werden in Zukunft am stärksten von der Klimakrise betroffen sein, obwohl sie am wenigsten dazu beigetragen haben. Was wir versuchen, ist, über einen Individualantrag Teile des Klimaschutzgesetzes anzufechten, und uns dabei – erstmalig – unmittelbar auf die Kinderrechte zu berufen. Ein spannender Punkt dabei ist, ob Kinder überhaupt Gesetze anfechten dürfen, die formell gar nicht an sie adressiert sind. Das ist grundsätzlich ein großes Problem, weil es kaum ein Gesetz gibt, das Kinder als Normadressat*innen anführt, auch wenn sie die rechtlichen Auswirkungen zu tragen haben. Im Fall des Klimaschutzgesetzes bedeutet das konkret, dass das wissenschaftlich begrenzte Treibhausgasbudget heute verbraucht wird, ohne an morgen zu denken. Das ist deshalb möglich, weil das Klimaschutzgesetz keinen effektiven Rahmen schafft, um dieses Budget gerecht zu verteilen.
Falls wir dieses Verfahren gewinnen, wäre klargestellt, dass ein Klimaschutzgesetz in dieser Form Verfassungsrechte verletzt. Zusätzlich würde es bedeuten, dass sich Kinder unter bestimmten Umständen unmittelbar auf ihre ureigenen Rechte stützen können, um die Zulässigkeitshürde zu schaffen. Das wäre wichtig, weil damit tatsächlich ein Zugang zum Recht ermöglicht würde. Insofern käme ein positiver Entscheid in mehrfacher Hinsicht einem juristischen Erdbeben gleich.
Ich möchte nochmals betonen, dass dieses Verfahren nicht auf das gesamte Klimaschutzgesetz abzielt, sondern auf die erwähnten Aspekte. Das Klimaschutzgesetz insgesamt zu Fall zu bringen, würde keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung der Situation bedeuten. Es gibt europarechtlich keine Verpflichtung zur Schaffung eines Klimaschutzgesetzes. Unser Ziel ist also, dass Teile der bestehenden Regelung gestrichen werden, sodass das aktuelle Klimaschutzgesetz effektiver wird. Dazu gehört etwa, dass es festgelegte Reduktionszeiträume geben muss; dass es eine Pflicht zur Umsetzung der Maßnahmen geben muss; und dass es keine ausschließlich retrospektiv orientierte Handlungsbasis bei der Setzung von Notfallmaßnahmen geben darf.
Wird das Verfahren gewonnen, dann kommt es nicht nur zu einer Verbesserung des Klimaschutzgesetzes, sondern Kinder bekommen dann auch ein Recht auf einen effektiven Klimaschutz. Sie könnten nach dieser Entscheidung diese Rechte unmittelbar einfordern, wenn sie sich auf ihre Verfassungsrechte stützen. Beschreiben lassen sich die konkreten Folgen heute noch nicht: Das wird davon abhängen, wie die Entscheidung des Gerichts formuliert ist.
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo