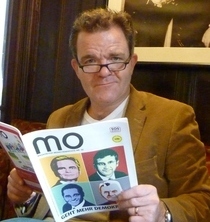Feuer am Dach
„Wir haben alles probiert, die Politik hat nicht reagiert.“ Die „Letzte Generation“ nützt geschickt die Medienökonomie, um überfällige Klimamaßnahmen der Regierung einzufordern. 60 Wissenschaftler*innen solidarisieren sich. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Text: Gunnar Landsgsell

Druck von der Straße: Trotz der Klimaziele steigen die klimarelevanten Emissionen (bis auf die
Corona-Zeit) jedes Jahr. Die Klimaneutralität bis 2040 rückt in weite Ferne.
Ende Februar, die „Letzte Generation“ setzt ihre Straßenproteste mit einer Aktionswoche in Wien fort. Am Döblinger Gürtel eskaliert die Situation. Ein Lieferwagen will die Blockade durchbrechen, es kommt zum Körperkontakt zwischen Fahrzeug und Aktivistin. Eine Wienerin rastet aus, tritt eine Aktivistin begleitet von derben Flüchen. Ein bulliger Mann steigt aus seinem Audi-SUV mit ausländischem Kennzeichen, attackiert ein Mitglied der „Letzten Generation“, das filmt und schleift mehrere Aktivist*innen von der Straße. Begleitet wird das von einem wilden Hupkonzert. Als Autos loszufahren versuchen, streckt sich ein Aktivist äußerst riskant auf der Fahrbahn aus. Bange Minuten. Die Situation kommt erst unter Kontrolle, als die Polizei eintrifft und beginnt, den Verkehr auf einer Fahrspur vorbei zu lotsen, während Beamte die Hände festgeklebter Aktivist*innen von der Straße lösen. Allein an diesen Szenen erkennt man, die „Letzte Generation“ ist mittlerweile öffentlich bekannt. In einer Stadt, in der Staus zum Alltag gehören (über die Südosttangente schieben sich täglich fast 200.000 Autos), steigt das emotionale Level innerhalb weniger Sekunden.
_______
„ES IST FEUER AM DACH. WIR SIND
MITTEN IN DER KLIMAKRISE.“
JÜRGEN CZERNOHORSZKY,
KLIMASTADTRAT IN WIEN
_______
Am gleichen Tag veröffentlicht orf.at eine Umfrage, wie die Bevölkerung zu den Klimaprotesten steht. Das Ergebnis: 58 Prozent der Österreicher*innen finden es gut, auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Fast die Hälfte der Befragten findet sogar, dass die Forderungen der „Letzten Generation“ berechtigt sind. Das wären Tempo 100 auf der Autobahn, 80 auf der Landstraße und 30 in der Stadt sowie ein sofortiger Stopp von neuen Bohrungen nach Erdöl- und Erdgas. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten lehnt es aber ab, sich dafür auf der Straße festzukleben und den Verkehr zu blockieren. Auch daran erkennt man, wie ambivalent die Situation ist: Offenkundig muss die Politik dringend Maßnahmen setzen, um die jährlich steigenden Emissionen an Treibhausgasen zu senken. Aber die Öffentlichkeit, die die „Letzte Generation“ mit ihren kompromisslosen Aktionen geschaffen hat, wird von der Diskussion über die Legitimität der Proteste zum Teil wieder aufgefressen.

Die Mikrobiologin Martha Krumpeck am Schwedenplatz. Ihre Sorge, dass
Kipppunkte das globale Klima entgleisen lassen, teilt auch die UNO.
Diese Ambivalenz findet sich selbst beim Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ), der nach eigenen Worten die Anliegen der Proteste mitträgt, aber in einer etwas schiefen Metaphorik meint, „eine festgeklebte Hand kann man nicht ausstrecken.“ Und es erstaunt, wenn er nach bald 30 globalen Klimakonferenzen meint: „Die Politikerinnen und Politiker allein hätten wahrscheinlich die Dringlichkeit nicht erkannt.“ Denn, es sei „Feuer am Dach. Wir sind mitten in der Klimakrise. Jeder, der sagt, es muss mehr getan werden, ist für mich jemand, der uns auch die Kraft gibt, vielleicht auch den notwendigen Tritt in den Allerwertesten, als Politikerinnen und Politiker auch zu liefern.“ Doch nun gehe es darum, „Menschen mitzunehmen“. Aber geht es wirklich darum, Menschen mitzunehmen, wo eine Mehrheit Klimamaßnahmen verlangt? Sind die Aktionen von Gruppierungen wie die „Letzte Generation“, wie „Extinction Rebellion“ oder „Just Stop Oil“ nicht vor allem an die Politik adressiert, endlich zu handeln?
Anja „Shakira“ Wendl, Aktivistin der „Letzten Generation“. Am Asphalt
bleibt manchmal auch ein Stück Haut kleben.
Alarmsignal für die Politik
Tatsächlich haben drei Viertel der unter 30-Jährigen das Gefühl, ihre Anliegen zum Klimaschutz würden nicht ernst genommen. Das ergab eine große Umfrage, die die Bundesjugendvertretung (BJV) kürzlich präsentiert hat. Sabir Ansari, Vorsitzender der BJV, wertet das als „Alarmsignal für die Politik“, die von den Jugendlichen ganz klar in der Verantwortung gesehen wird. „Wir erleben Hitzerekorde im Sommer und Frühlingstemperaturen im Winter. Seit Jahren demonstrieren Jugendliche“, so Ansari. Dennoch schaffe es die Politik in Österreich nicht, Maßnahmen für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zu setzen, etwa in Form eines Klimaschutzgesetzes. Deshalb seien „drastische Protestaktionen“ auch verständlich.
Die Umfrage deckt sich mit anderen Studien, wonach die größte Sorge bei Jugendlichen das Klima und ihre Zukunft betrifft, während das Vertrauen in die Politik bzw. in die Parteien sich im unteren zweistelligen Bereich bewegt. Eine fatale Konstellation, weil die Jugend offenbar niemand sieht, der Verantwortung übernimmt. Ins gleiche Horn stößt auch Florian Wagner, Sprecher der „Letzten Generation“ in Österreich. Er meint im Gespräch: „Wir haben alles probiert, die Politik hat nicht reagiert. Wir wissen nicht, was wir noch machen sollen.“ Das entgegne man auch aufgebrachten Bürger*innen bei den Aktionen. Wagner: „Wir schaffen es immer wieder, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die zuvor noch auf gut Wienerisch geschimpft haben.
________
LAUT MEHREREN UMFRAGEN STEHT
DIE SORGE UM DAS KLIMA UND DIE
ZUKUNFT DES PLANETEN AN ERSTER
STELLE BEI JUGENDLICHEN.
________
Und wir fragen sie: Was sollen wir tun? Die Antwort ist dann, man müsse vor dem Parlament demonstrieren, bei der OMV, bei den Bösen. Wir sagen ihnen dann: Da waren wir überall. Und offenbar hätten sie das nicht mitgekriegt, weil es niemand gestört hat und deshalb auch die Medien nicht berichtet haben. Viele verstehen das – und ändern ihre Meinung. Außer natürlich die, die rasend vor Wut sind.“
Wieder Bewegung reingekommen
Florian Wagner ist jemand, der seine Worte bedächtig wählt, kein emotionaler Typ. Er kommt aus dem Waldviertel, wo es einen ziemlichen Freiheitsgewinn bedeutet, ein Auto zu haben, wie er meint. So wie fast überall am Land. Wie aber ist er selbst zum Klimaaktivisten geworden? Wagner: „Ich habe mit zwölf Jahren mein erstes Referat über den Treibhausgaseffekt gehalten. Zu dieser Zeit tourte Al Gore mit ‚Eine unbequeme Wahrheit‘. Ich habe dann den Bachelor in Agrarwissenschaften auf der BOKU gemacht und danach Mathematik und politische Ökonomie studiert.

Immer wieder kommt es Übergriffen auf die Aktivist*innen, sie werden bespuckt, beschimpft,
attackiert. Deshalb warten sie mit dem Kleber, bis sie die Polizeisirenen hören.
Die Ambivalenz der Aktionen sei der Gruppe vollkommen bewusst. Wagner: Proteste wie jene in England, von wo die „Letzte Generation“ ausging, waren schon seit Jahren ins Leere gelaufen. Also hätten Leute probiert, das „disruptive Element“ zu steigern, über Sitzblockaden und indem sie sich festklebten. Das sei am effektivsten gewesen. Tatsächlich sei er schon öfters auch aus seinem Umfeld gefragt worden, ob es nicht blöd sei, sich auf der Straße festzukleben. „Mittlerweile sage ich: Ja, natürlich, aber in der Medienlogik in Verbindung mit der Autokultur ist das einfach sehr wirksam.“
Zuerst hätten nur Boulevardzeitungen über die Aktionen berichtet. Das wäre wichtig gewesen. Eine Aktion in der Anfangszeit, bei der keine Zeitung auftauchte, war so, als hätte es sie nie gegeben. Später seien Qualitätsblätter aufgesprungen und hätten mehr inhaltliche Tiefe in die Diskussion gebracht. Mittlerweile zogen einige Politiker*innen nach, äußerten sich positiv zur Forderung nach Tempolimits. Insofern sei also wieder Bewegung in die Debatte gekommen. Doch Bewegung wohin?
Die Proteste der „Letzten Generation“ stehen
selbst in Diskussion, zurecht?
Den Blick schärfen
Als Türöffner zu einer breiten Öffentlichkeit und inhaltliches Hemmnis gleichermaßen erweist sich der Aktionismus. Monatelang waren Tageszeitungen und das Fernsehen vor allem mit der Frage der Legitimität des Protests beschäftigt. Erst die Solidarisierung von 60 prominenten Wissenschaftler*innen mit der „Letzten Generation“ half, aus dieser Wahrnehmungsnische zu kommen. Initiiert hat das Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik. Während also Teile der Politik (wie Landeshauptfrau Mikl-Leitner im NÖ-Wahlkampf) anstatt auf die inhaltlichen Anliegen zu reagieren, strafrechtliche Konsequenzen forderten, korrigierten Wissenschaftler den Fokus wieder.
Am Wiener Praterstern, wo 18 Aktivist*innen festgenommen wurden, bezeichnete etwa der Biologe Franz Essl, 2022 zum Wissenschaftler des Jahres gewählt, friedliche aber „disruptive Protestformen“ angesichts der dramatischen Klimaentwicklungen als legitim. Und er skizzierte in dramatischen Worten, wohin sich der Planet unter den derzeitigen Vorzeichen bewegt. Die Halbierung der CO2-Emissionen bis 2030 scheine kaum noch realistisch. Deshalb sieht auch die Mikrobiologin Martha Krumpeck, Initiatorin der „Letzten Generation“ in Österreich, den „zivilen Widerstand“ als letzte Hoffnung an.
_______
DER KAMPF UM DIE ZUKUNFT FINDET
NUN AUCH JURISTISCH STATT.
12 JUGENDLICHE HABEN BEIM
VERFASSUNGSGERICHTSHOF GEKLAGT.
_______
Wie eine Welt mit einer globalen Erwärmung von zwei Grad Celsius (die in Österreich schon erreicht wurden) oder drei Grad aussieht, lässt sich in verschiedenen Szenarien nachlesen. Die berüchtigten Kippunkte könnten das Klima mit verheerenden Auswirkungen tatsächlich „kippen“ lassen. Berechnungen der UNO gehen davon aus, dass ohne ausreichende Reduktion der Emissionen die Erde bereits 2070 ein anderer Planet wäre, als wir ihn kennen. Krumpeck wird also nicht müde zu betonen, dass mit der letzten Generation alle heute lebenden Menschen gemeint sind, die mit ihrem Verhalten das Ruder noch herumreißen kann.

Der Ökologe Franz Essl, zum Wissenschaftler des Jahres 2022 gekürt, sieht die gewaltlose aber
„disruptive“ Protestform angesichts dessen, was droht, für legitim an.
In der jungen Generation scheint man daran nicht mehr so recht zu glauben. Deshalb hat sich der Kampf um die Zukunft schon seit einiger Zeit von der Straße auch in die Gerichte verlagert. In Deutschland wurde im April 2021 ein bahnbrechendes Urteil verkündet. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte die Verfassungsklage von neun jungen Menschen, die aufgrund von Versäumnissen der Regierung ihr Recht auf Zukunft eingeklagt hatten. Und Ende Februar klagte die Rechtsanwältin Michaela Krömer im Namen von zwölf Kindern und Jugendlichen beim Verfassungsgerichtshof gegen das unzureichende Klimaschutzgesetz. Bei allem Ärger über die „Klimakleber“, es wäre Zeit, den Fokus wieder schärfen.
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo