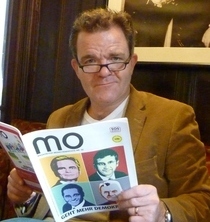„Wir brauchen Aussteigerprogramme“
Die Demonstrationen gegen die Corona-Präventions-Maßnahmen der Regierung haben während der Pandemie-Jahre gezeigt: Antisemitismus wurde öffentlich zur Schau gestellt. Ein Gespräch mit Willi Mernyi, leitender Sekretär im ÖGB und Vorsitzender des Mauthausen Komitees Österreich, über Judenfeindlichkeit, einen positiven Wandel bei Bürgermeister*innen und das Problem mit hohen Strafen bei Wiederbetätigung. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Interview: Alexia Weiss, Fotos: Karin Wasner

Willi Mernyi: arbeitet unermüdlich gegen antisemitische Tendenzen.
Manche Reaktion lässt auf wenig Sensibilität schließen.
Antisemitismus war während der Hochzeit der Coronapandemie wieder massiv Thema. Im Zug der Demonstrationen von Gegnern der Covid-Präventions- und Schutzmaßnahmen von Masken bis Impfungen waren antisemitische Slogans und Symbole auch im öffentlichen Raum zu sehen. Was sind Ihre Lehren aus diesen Vorfällen?
Wir mussten schmerzlich erfahren, wenn wir vor Ort mit Leuten darüber diskutiert haben, dass sie gemeinsam mit Antisemit*innen auf die Straße gehen, dass viele Menschen gesagt haben, mag sein, aber das ist mir wurscht. Sie meinten, uns geht es darum, gegen die Corona-Diktatur zu protestieren. Als wir sie darauf hingewiesen haben, dass sie sich von Neonazis anführen lassen, sagten sie, es ist uns egal, wer da vorne geht, wir sind da.
Was bedeutet das für die Arbeit gegen Antisemitismus?
Alle, die die Frage stellen, ob es im Jahr 2025 wieder ein Jubiläumsjahr braucht, kann man auf die Corona-Demos hinweisen und sagen: Ich habe schon das Gefühl. Mir wäre lieber, es wäre anders.
Man muss das Thema also weiter öffentlich diskutieren und darf keinen Schlussstrich bei der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ziehen. Das zeigen auch Fälle, wo Menschen Symbole wie die „Schwarze Sonne“ verwendeten. Sie haben vergangenes Jahr darauf hingewiesen. Viele Menschen wissen aber gar nicht, dass das SS-Symbole sind. Warum ist es Ihnen dennoch wichtig, das aufzuzeigen?
Ich bin vorsichtig, wenn es um die Frage geht, ob jemand weiß, was das ist oder nicht. Es gibt Fälle, wo wir Personen auf die Bedeutung eines Symbols aufmerksam machen und die dann sagen, sie wussten es nicht und entfernen es dann sofort. Diese Fälle machen wir auch gar nicht medial öffentlich, diese Menschen outen wir nicht. In einem Fall handelte es sich aber zum Beispiel um einen 33-Jährigen, der ein Hakenkreuz tätowiert hatte. Wenn er sagt, er habe gedacht, es handle sich um ein indisches Zeichen, fühle ich mich verarscht.
Sind das neue Subkulturen oder nur einzelne Rechtsextreme, die ihr Gedankengut nach außen tragen?
Früher haben Rechtsextreme Springerstiefel getragen und waren als Skinheads erkennbar. Heute kleiden sie sich unauffällig und arbeiten mit Codes, aber es ist die gleiche Ideologie. Das macht es gefährlicher. Wer also bestimmte Symbole verwendet, zeigt anderen, wir gehören zusammen. Und der Unterschied zu den Rechtsextremen von früher ist, dass sie vom Rand der Gesellschaft in die Mitte gerückt sind. Rechtsextremismus ist inzwischen salonfähig geworden. Früher haben sich Betriebsräte gemeldet und gesagt, ich habe da einen Neonazi, was können wir da machen? Heute habe ich Betriebsräte, die sagen, es sind vier oder fünf. Und du hast dann keinen Antisemitismus, weil es wenige Juden und Jüdinnen im Arbeitskontext gibt. Aber du hast Leute, die sagen, ich arbeite nicht mit Türken. Das wird dann für das Einteilen einer Partie ein Problem.
Die Ideologie richtet sich also gegen verschiedene Gruppen? Genau. Stichwort Information: Sie bemühen sich sowohl als Leitender Sekretär im ÖGB, vor allem aber in Ihrer Funktion als Vorsitzender des Mauthausen Komitees Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus und gegen Antisemitismus nicht aufhören darf. Wird dieser Kampf immer zu führen sein?
Ich hoffe nicht. Ich hätte auch gerne einmal Ruhe. Aber der Punkt ist: Wir decken ja nicht etwas auf, was nicht da ist. Es haben sich aber auch Dinge zum Positiven verändert. Wir hatten früher Bürgermeister unterschiedlichster Couleur, nicht nur von ÖVP und FPÖ, die sich gegen Gedenktafeln gewendet haben. Wenn ungarische Juden im Zug eines Todesmarsches in einer Gemeinde ermordet wurden, sagte der Bürgermeister, das waren ja keine von uns, machen wir doch eine Gedenktafel, wo sie geboren wurden. Dieser Wahnsinn ist inzwischen vorbei. Auf der anderen Seite gibt es immer noch Gemeinden, die sagen, das ist nicht gut für den Tourismus, aber es gibt nicht mehr diese blanke Ablehnung.
Über Rechtsextremismus haben Sie nun schon einiges erzählt. Judenfeindlichkeit gibt es aber nicht nur von rechter Seite. Welche Formen des Antisemitismus sehen Sie in Österreich und welche erscheinen Ihnen derzeit am gefährlichsten?
Meiner Ansicht nach ist es noch immer der klassische Antisemitismus von rechts, aber in Ermangelung von Juden wendet er sich marketingtechnisch zum Beispiel gegen türkische Menschen. Nach innen ist aber dann von der Ostküste etc. die Rede, also alles wie gehabt. Natürlich gibt es auch den Antisemitismus bei Migrant*innen. Vor einigen Jahren haben wir da auch gemeinsam mit der Volkshilfe eine Broschüre zu den Grauen Wölfen gemacht. Der ist da, den braucht man nicht zu verharmlosen, aber auch nicht aufzublasen. Man muss ihn bekämpfen, genauso wie den anderen. Einen Unterschied sehe ich aber doch: Die Migrantenkids sind offen, wenn wir Begegnungen organisieren, um Vorurteile zu entkräften. Bei Rechtsextremen ist es ein Weltbild.

Früher haben sich Rechtsextreme einer Diskussion gestellt und heldenhaft verloren.
Heute machen sie das nicht mehr
Und wie beurteilen Sie linken Antisemitismus, der sich etwa als Engagement für die Israel-Boykott-Bewegung BDS zeigt?
Manchmal ist es schon so, dass ich mir bei der Darstellung von Kapitalisten denke, man könnte sorgfältiger darauf achten, hier keine antisemitischen Stereotype zu transportieren. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass das absichtlich ist. Und bei der Diskussion um Israel gibt es Wortmeldungen, bei denen ich mir denke, ist jetzt die israelische Bevölkerung oder die israelische Regierung gemeint? Ich würde das aber nicht gleichsetzen mit rechtem Antisemitismus. Das ist schon eine andere Kategorie.
Was leistet hier das Mauthausen Komitee konkret an Vermittlung? Sie haben schon über migrantische Jugendliche gesprochen. Wie begegnen Sie rechtsextremen Jugendlichen?
Früher haben sich Rechtsextreme einer Diskussion gestellt und heldenhaft verloren. Heute machen sie das nicht mehr. Bei einer Begleitung in Mauthausen haben mir die Lehrlinge und Lehrer schon gesagt, da ist ein Rechter, bei dem muss man aufpassen. Der hat die ganze Zeit nichts gesagt, nicht ein Wort. Der hat mich nur angelächelt. Aber beim Verabschieden, er war der letzte, hat er mir die Hand gegeben und gesagt, im Bus gehören sie wieder mir. Bei den Angeboten sind wir vordergründig weggegangen vom Nationalsozialismus-Thema. Wir machen Zivilcourage-Trainings, und da ist man ohnehin sofort beim Thema. Es interessiert die Leute aber viel mehr, über Zivilcourage zu reden, über Mobbing, über Hate. Verstärkt haben wir hier auch die Angebote zu Hass im Netz.
Wird der Kampf gegen Antisemitismus andererseits auch politisch instrumentalisiert?
Ich habe manchmal bei der ÖVP das Gefühl, dass es eine strategische Entscheidung ist, diese Gedenkkultur nicht der Linken zu überlassen. Das finde ich erunsympathisch, weil Gedenkkultur ist nicht links oder rechts, sie ist antifaschistisch. Der Mittelschüler-Kartell-Verband und der CV waren total erstaunt, als ich sie persönlich eingeladen habe, bei der Befreiungsfeier in Mauthausen dabei zu sein, in voller Montur, aber ohne Säbel. Es waren 300 von ihnen bei der Befreiungsfeier und das war so schön. Und dann habe ich in der MKV-Zeitung von einem MKV-Funktionär gelesen, dass das der schönste Moment seiner politischen Tätigkeit war, dass er mit der Sozialistischen Jugend und der Muslimischen Jugend am Appellplatz gestanden ist und keiner hat den anderen deppert angeschaut oder blöde Witze gemacht. Jeder hat respektiert, wir gedenken hier gemeinsam der Opfer. Das ist kein Ort für Parteipolitik.

Die Migrantenkids sind offen, wenn wir Begegnungen organisieren, um Vorurteile zu
entkräften. Bei Rechtsextremen ist es ein Weltbild.
Welche Rolle spielt die FPÖ, wenn es um Antisemitismus geht? Sie fährt hier einen Schlingerkurs mit öffentlichen Bekenntnissen dagegen, dann taucht aber wieder in der zweiten oder dritten Reihe ein rechtsextremer Einzelfall auf. Wie ist das zu bewerten?
Wir haben ja auch eine Einzelfall-Broschüre herausgegeben. Es gibt hunderte Einzelfälle in der FPÖ. Das glaubt niemand. Und man sieht auch, dass diese vermeintliche Abkehr von diesem Gedankengut parteipolitisch motiviert war. Als die Freiheitlichen in der Regierung waren, haben sie sich von den Identitären distanziert. Und jetzt sind sie wieder auf Kuschelkurs. Das ist das wahre Wesen der FPÖ.
Die ÖVP hat als Regierungspartei den Nationalen Aktionsplan gegen Antisemitismus vorgelegt, der nun implementiert wird. Wie bewerten Sie diesen Aktionsplan?
Der Ansatz ist der richtige, aber es könnte schneller gehen. Jetzt wird das Verbotsgesetz geändert, wo wir auch eingebunden waren. Der Prozess läuft und ich gehe davon aus, dass am Ende etwas Gutes herauskommt.
_______
WIRD DER KAMPF GEGEN ANTISEMITISMUS
EWIG ZU FÜHREN SEIN?
ICH HOFFE NICHT. ICH HÄTTE AUCH
GERN EINMAL RUHE.
_______
Was soll konkret geändert werden?
Es geht vor allem um Strafen. Die Strafen bei Wiederbetätigung sind sehr hoch, und das hört sich jetzt komisch an, aber hohe Strafen führen oft dazu, dass Geschworene sagen, er ist schuldig, aber die Strafe wäre zu hoch. Das bringt nichts. Dann geht es auch um die Diskussion um bestimmte Abzeichen und die Frage, ob eine Diversion bei er wachsenen Täter*innen möglich sein soll. Wir und das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands (DÖW) sind hier sehr kritisch, was die Frage der Diversion bei Erwachsenen betrifft. Und leider bekommen wir für eine Forderung zwar die Unterstützung der Grünen, aber nicht der ÖVP.
Was fordern Sie?
Wir brauchen Aussteigerprogramme. Die Deutschen machen das seit Jahrzehnten. Wir wissen genau, wie das funktioniert und welche Behörden da zusammenspielen müssen. Aber in Österreich schaffen wir kein Aussteigerprogramm, obwohl es ohnehin nur eine kleine Szene gibt. Die ÖVP hat dies leider bisher immer verhindert und gemeint, das sei nicht nötig, Leute, die aussteigen wollen, sollten sich an die Polizei wenden. Wer wendet sich da aber an eine Strafbehörde? Das ist so lächerlich. Wir brauchen eine Aussteigerhilfe, bei der die Polizei, aber auch Einrichtungen wie das AMS und die Gemeinden als Partner eingebunden sind. Betroffene müssen heraus aus ihrem bisherigen Umfeld.
Und wie sollte man mit dem Rechtsextremismus umgehen, der in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist? Wie könnte hier eine Exit-Strategie aussehen?
Am besten ist natürlich Information, aber auch das tabulose Ansprechen und Benennen von Rechtsextremismus, egal ob er in der Mitte oder am Rand ist.
Alexia Weiss, geboren 1971 in Wien, ist freie Journalistin und Autorin. Aktuell schreibt sie v.a. über jüdische und sozialpolitische Themen. In ihrem zuletzt erschienenen Buch „Zerschlagt das Schulsystem ... und baut es neu!“ (Verlag Kremayr & Scheriau) setzt sie sich mit der Frage auseinander, wie eine chancengerechtere Schule nicht nur dem Einzelnen helfen, sondern auch das Fundament für eine gerechtere Gesellschaft bilden könnte.
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo