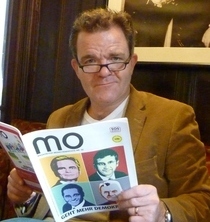Handlungsbedarf: Wundbrand verhindern
Warum es wichtig ist, die extreme Rechte in Österreich nicht an die Hebel der Macht zu lassen. Kommentar: Alexander Pollak, Illustration: Petja Dimitrova
Bei der Bundespräsidentenwahl hat eine Mehrheit von 54 Prozent der Stimmen verhindert, dass die extreme Rechte in Österreich mit einem der höchsten Ämter der Republik ausgestattet wird. Jetzt stehen erneut Wahlen vor der Türe. Eine Reihe an BeobachterInnen geht davon aus, dass eine Regierungsbeteiligung der extremen Rechten wahrscheinlich ist.
Während viele in der Bevölkerung den Ernst der Lage erkannt und an der einzigartigen Mobilisierung für einen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen mitgewirkt haben, scheinen andere der Normalisierung des Rechtsextremismus sorglos entgegenzublicken.
Offenbar tut es dringend Not, einmal mehr und immer wieder darzulegen, warum es wichtig ist, die VertreterInnen der extremen Rechten nicht mit Regierungsmacht auszustatten. Fangen wir bei dem an, was die Rechte gut kann: Sie erkennt Unzufriedenheit. Sie identifiziert Problembereiche. Sie beherrscht es, den Finger auf wunde Punkte zu legen. Allerdings tut sie das nicht, um diese wunden Punkte zu heilen, sondern sie tut es, um einen Wundbrand zu erzeugen, der das Vertrauen in das demokratische System und in menschenrechtliche und soziale Errungenschaften nachhaltig schwächt.
Die Rechte greift Ängste auf, nicht um dahinter liegende Unsicherheiten zu beseitigen, sondern um einen Zustand der permanenten Beunruhigung zu erzeugen. Sie spricht Identitätsfragen an, nicht um allen Menschen Zugehörigkeit zur Gesellschaft zu ermöglichen, sondern um unversöhnliche Fronten zu schaffen. Sie benennt Probleme, nicht um Lösungen zu erarbeiten, sondern um radikalen Nationalismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu propagieren.
Gegen Normalisierung des Rechtsextremismus
Die extreme Rechte an der Macht bedeutet nicht „nur“ eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Korruption – die Vergangenheit hat gezeigt, dass Politiker, die ohne Skrupel hetzen, oftmals auch keine Skrupel haben, korrupt zu handeln und in die eigene Tasche zu wirtschaften. Die extreme Rechte an der Spitze von Ministerien oder Staatssekretariaten bedeutet auch und vor allem, dass ihre VertreterInnen mit der Möglichkeit ausgestattet werden, über das Rhetorische hinausgehend mittels Verordnungen und Gesetzen Integration zu torpedieren und einen zerstörerischen Keil zwischen Menschen entlang von Kriterien wie Herkunft oder Religionszugehörigkeit zu treiben.
Im Jahr 2000 löste der Eintritt der FPÖ in die Bundesregierung eine Welle des Protests aus. Es kam zu Großdemonstrationen und wöchentlichen Protestmärschen. Der Aufschrei und der öffentliche Druck blieben nicht ohne Wirkung. Der damalige Bundespräsident Thomas Klestil lehnte mehrere Ministervorschläge der FPÖ ab. Darüber hinaus musste die Regierung eine einleitende Präambel zu ihrer Regierungserklärung verfassen. Darin erklärte sie „ihre unerschütterliche Verbundenheit mit den geistigen und sittlichen Werten, die das gemeinsame Erbe der Völker Europas sind“. Weiters musste die ÖVP-FPÖ-Regierung versprechen, „für Respekt, Toleranz und Verständnis für alle Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschauung“ einzutreten.
Inzwischen sind mehr als 17 Jahre vergangen. Die extreme Rechte hat sich verändert. Sie ist noch ideologisierter geworden. Sie ist in ihren Forderungen nach sozialer Spaltung noch radikaler geworden. Und sie ist noch gefährlicher geworden, weil sie besser organisiert und nicht mehr nur auf eine einzelne Führungsperson zugeschnitten ist.
Bislang haben weder ÖVP noch SPÖ ein klares Bekenntnis dazu abgegeben, Rechtsextreme nach der kommenden Wahl nicht in Ministerämter zu befördern. Das ist skandalös.
Es gilt daher in den kommenden Wochen vehement ein solches Bekenntnis einzufordern. Das ist unser Recht, ich würde sogar sagen, unsere Pflicht.
Soeben erschienen:

Alexander Pollak
Zwanzig Erfolgsfaktoren der extremen Rechten.
Zwanzig Gegenstrategien.
Books on Demand 2017
132 Seiten, € 11,90
ISBN: 978-3744819503
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo